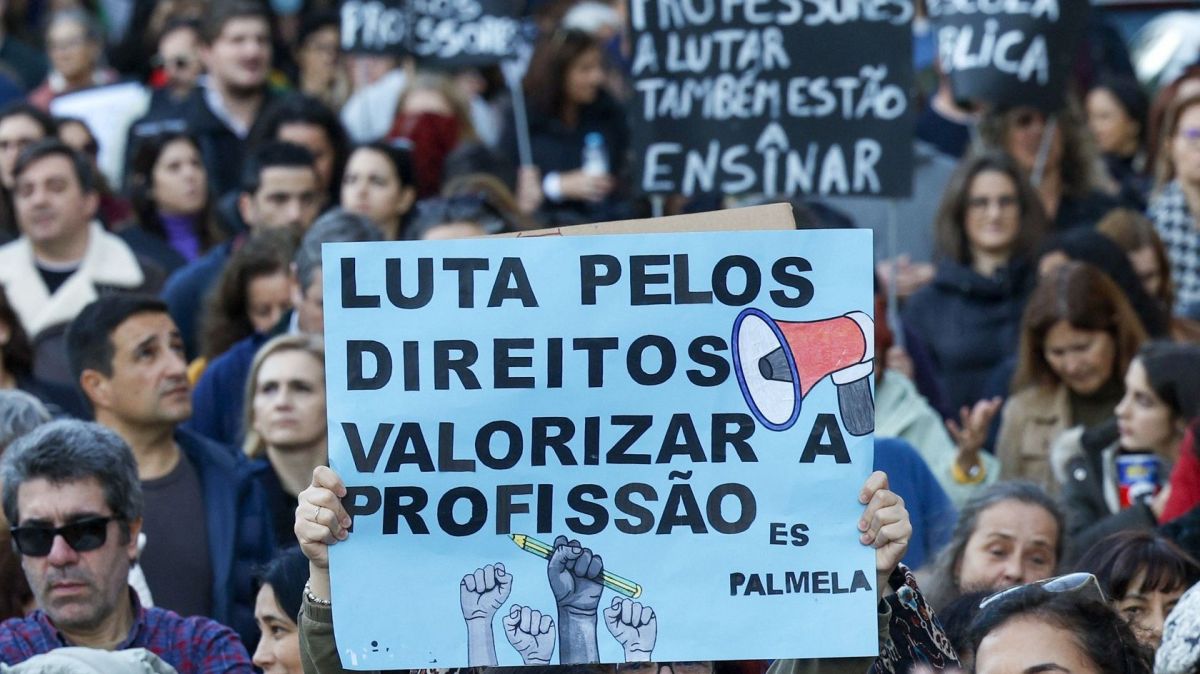Unter dem Titel Optimizing Energy Efficiency with PCM Integration in Portuguese Residences (3D-EE.Struct) konzentriert sich das Projekt auf die Integration von Phasenwechselmaterialien (PCM) in Gebäudekomponenten wie Wände, Decken und Böden, um die Wärmeregulierung zu verbessern und den Energieverbrauch zu senken, so eine Erklärung der FCTUC vom 30. Juli.
Diese innovativen Materialien funktionieren wie Wärmebatterien, indem sie die Innentemperaturen auf natürliche Weise regulieren. Sie speichern tagsüber Wärme und geben sie bei Bedarf wieder ab, wodurch die Abhängigkeit von mechanischen Heiz- und Kühlsystemen verringert wird, erklärte Ajitanshu Vedrtnam, Forscher bei der Association for the Development of Industrial Aerodynamics(ADAI) der FCTUC.
"Das Projekt 3D-EE-Struct konzentriert sich insbesondere auf Leichtbaustrukturen, die an das portugiesische Klima angepasst sind", so Vedrtnam. "Zu seinen Hauptzielen gehören die Senkung des Energieverbrauchs und der Treibhausgasemissionen von Haushalten, die Entwicklung praktischer und bewährter Strategien für die PCM-Integration in Neubauten und Sanierungen sowie die Optimierung der PCM-Platzierung und -Auswahl."
Das Projekt zielt auch darauf ab, den thermischen Komfort zu verbessern und gleichzeitig die Energierechnungen deutlich zu senken.
Nelson Soares, Professor im Fachbereich Maschinenbau an der FCTUC und ADAI-Forscher, erklärte, dass das Projekt hofft, "bis zu 25 % Energieeinsparungen beim Heiz- und Kühlbedarf in kleinen Häusern" zu erreichen.
Das Team plant außerdem, Simulationsmodelle in einer realen Wohnung in Coimbra zu testen, klimaangepasste und erschwingliche Wohnlösungen zu unterstützen und wissenschaftliche Werkzeuge und Gebäudestrategien bereitzustellen, um die zukünftige Forschung und kommerzielle Entwicklung im Bereich des nachhaltigen Bauens zu unterstützen.
Das von der Universität Coimbra koordinierte Projekt, an dem Mitarbeiter aus Portugal, den USA, der Slowakei und Indien beteiligt sind, wurde im Rahmen des Programms "Horizont Europa" mit einem Marie-Skłodowska-Curie-Postdoktorandenstipendium in Höhe von rund 173 000 EUR gefördert.